Was ist Greenwashing?
In der Textilbranche wächst die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit. Immer mehr Konzerne recyclen ihre Stoffe, die meisten großen Anbieter haben sich verpflichtet, bis zum Jahr 2020 ihre Stoffe verstärkt ohne umwelt- oder gesundheitsschädliche Chemikalien zu produzieren. Aber können Akteure dieser Branche, die für Fast-Fashion bekannt ist, sich überhaupt nachhaltig nennen?

Die Antwort darauf ist: Ja, können sie. Aber nicht, weil sie tatsächlich nachhaltig sind, sondern weil der Begriff der Nachhaltigkeit nicht rechtlich geschützt ist und keine klare Definition hat. So können Unternehmen für die Nutzung des Begriffs trotz widersprüchlichen Verhaltens zumindest nicht gesetzlich in die Verantwortung gezogen werden.
Konsument*innen sollten sich aber die Frage stellen, ob einem hier nicht bloß eine Marketingtaktik untergejubelt wird, durch die Unternehmen sich grün waschen, also Greenwashing betreiben.
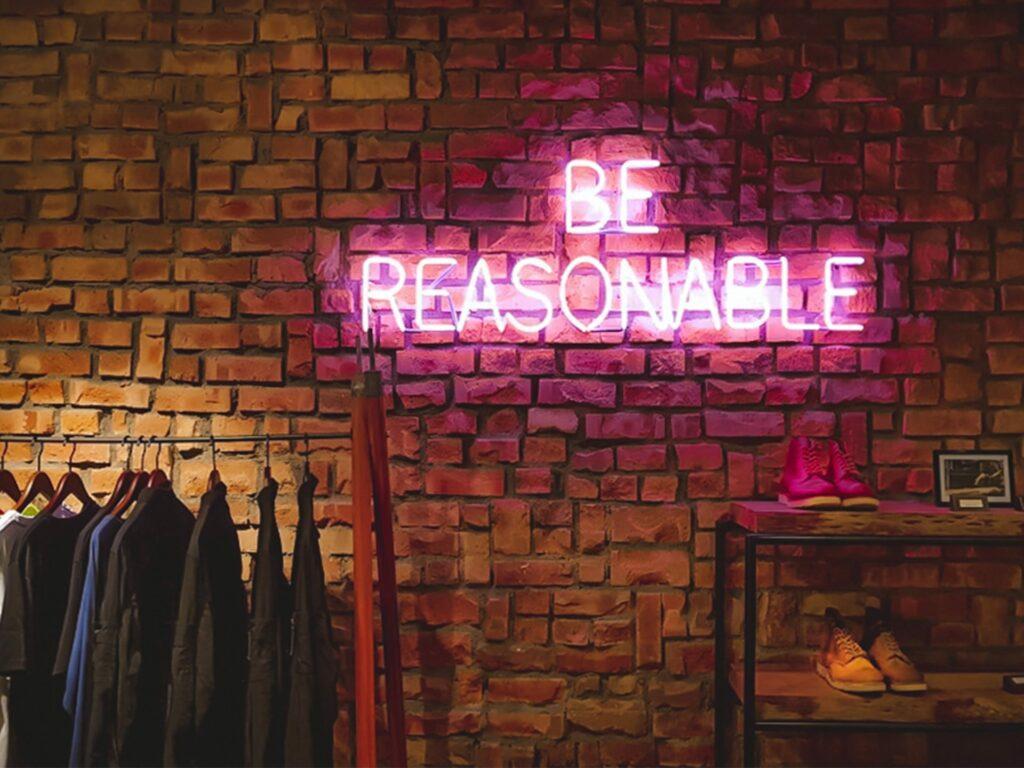
Greenwashing ist ein Begriff, der seit ca. 1960 genutzt wird, durch den amerikanischen Umweltaktivisten Jay Westerveld 1986 aber erst verbreitet wurde. Damit wird Unternehmen vorgeworfen, sich öffentlich besonders umweltfreundlich und nachhaltig zu präsentieren, diese Nachhaltigkeit aber in ihrem Kerngeschäft nicht umzusetzen. So wird von den Umweltsünden, die besonders die großen Konzerne begehen, abgelenkt.
Mit Nachhaltigkeit im Trend, wollen Kleidungsmarken auf die Schiene mit aufspringen, aber richtig nachhaltig, also Veränderungen in allen Bereichen des Unternehmens, wird man nicht über Nacht. Deshalb greifen viele von ihnen darauf zurück, nur einen kleinen Nebenteil nachhaltig, oder eben nur nachhaltiger, zu produzieren, während der Großteil des Umsatzes noch immer aus Fast-Fashion auf Kosten der Umwelt besteht.

Denn, die Fashionindustrie ist laut der Ellen MacArthur Foundation einer der größten Wasserverbraucher mit 93 Millionen Kubikmetern Wasser im Jahr, sie verbraucht um die 100 Millionen Tonnen endlicher Ressourcen und macht 10% des weltweiten CO2 Ausstoßes aus.
Da diese Fakten aber nicht allen bekannt sind, können Modeunternehmen falsche oder unvollständige Gegeninformationen nutzen, um sich zu greenwashen und mit ihrer Nachhaltigkeit zu werben.
Wie wird ge-greenwashed?
Greenwashing hat viele Taktiken, von denen die meisten auf den ersten Blick auch wirklich nachhaltig wirken.
So bieten Textilläden beispielsweise Recyclingcontainer an. Kunden können im Gegenzug für ihre alte Kleidung einen Einkaufsgutschein für Neues bekommen. Damit wird aber die Schnelllebigkeit der Fashionindustrie nur weiter angekurbelt, weil zum Neukauf angeregt wird.

Viele Marken nennen einzelne Produkte oder Kollektionen nachhaltig, aber, wenn man dann die Beschreibung liest, erfährt man, dass die Materialien nur zum Teil beispielsweise aus recycelten oder Bio-Stoffen sind. Zu den restlichen Bestandteilen findet man oft keine Informationen, da sie weiterhin umweltschädlich hergestellt werden.
Außerdem werben Unternehmen zunehmend mit Textilien aus nicht-Textil-typischen Materialien: Strumpfhosen aus Fischernetzen, Sporthemden aus recyceltem Plastikmüll und Lederimitat aus Resten, die bei der Ernte von Ananas anfallen. Das sind jedoch nur kleine Aktionen, die nicht größer umsetzbar wären. So müsste man für eine tatsächliche Ledersubstitution Unmengen an Ananaspflanzen haben, die nicht vorhanden sind.

Es werden auch Kampagnen gestartet, die in etwa laute: “Pro gekauftem Shirt pflanzen wir einen Baum.” So wird Konsument*innen das Gewissen zwar bereinigt, das tatsächliche Problem wird aber lange nicht gelöst. Auch übertriebene Statements, wie “Shoppe hier und rette den Planeten” sind irreführend und somit Greenwashing.

Der Schritt in die richtige Richtung, sei es weniger Chemie in der Produktion, mehr Bio-Anbau oder recycelte Baumwolle, wird zunichte gemacht, wenn der schnelle Konsum weiter beworben wird.
Wie erkennt man Greenwashing?
Die übertriebenen, schönen Beschreibungen, die zur Vermarktung der “nachhaltigen” Kollektionen genutzt werden, wie “conscious”, “slow fashion”, “eco-friendly” oder “100% Bio” sind leider oft nur Fassade, hinter die Konsument*innen erstmal blicken müssen, um nicht getäuscht zu werden.
Marken, die wirklich auf Nachhaltigkeit setzen, werden das mit Belegen und Informationen zu Produktion, Lieferung, Materialien usw. zeigen – schließlich ist es, wenn wahrheitsgemäß, eine tolle Werbung für die Textilien!
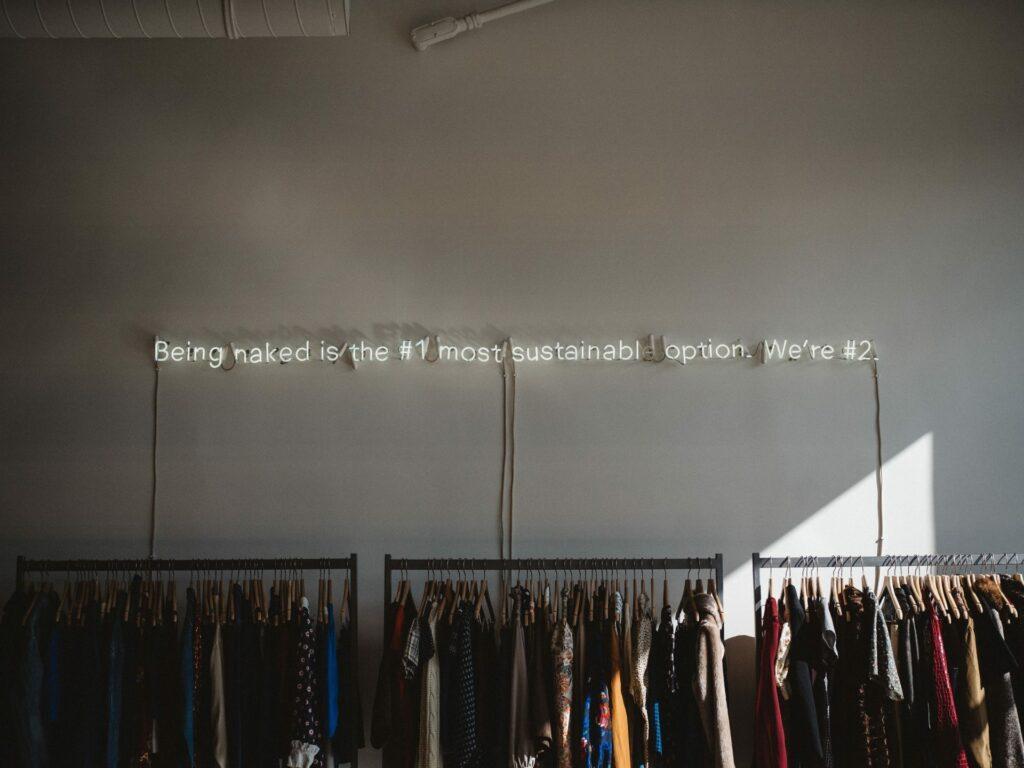
Mittlerweile behaupten viele Fashionunternehmen nicht nur hundertprozentige Biobaumwolle zu nutzen oder cruelty-free zu produzieren, sondern lassen sich das von Organisationen wie Fair Trade, EcoCert, PETA o.ä. zertifizieren. So haben Kunden einen Anhaltspunkt und können Vergleiche ziehen. Aber diese Zertifikate sind für kleine Unternehmen oft zu kostspielig. Hier kann man aber einfach nachfragen – kleine, nachhaltige Marken geben immer gerne Auskunft und agieren transparent.
Große Konzerne werben oft mit recyclebarer Verpackung, ändern aber nichts an den Abfällen, die bei ihrer Textilproduktion anfallen. Oder sie bringen eine nachhaltige Collection raus, die dann aber nur einen Bruchteil des gesamten Angebots ausmacht. Man muss sich also das große Ganze anschauen und überlegen, ob die Marke Nachhaltigkeit in alle Bereiche einbaut, also Konzeption, Produktion, Vermarktung, Vertrieb und Lieferung berücksichtigt, oder lediglich in den Bereichen, die direkt ins Auge fallen.
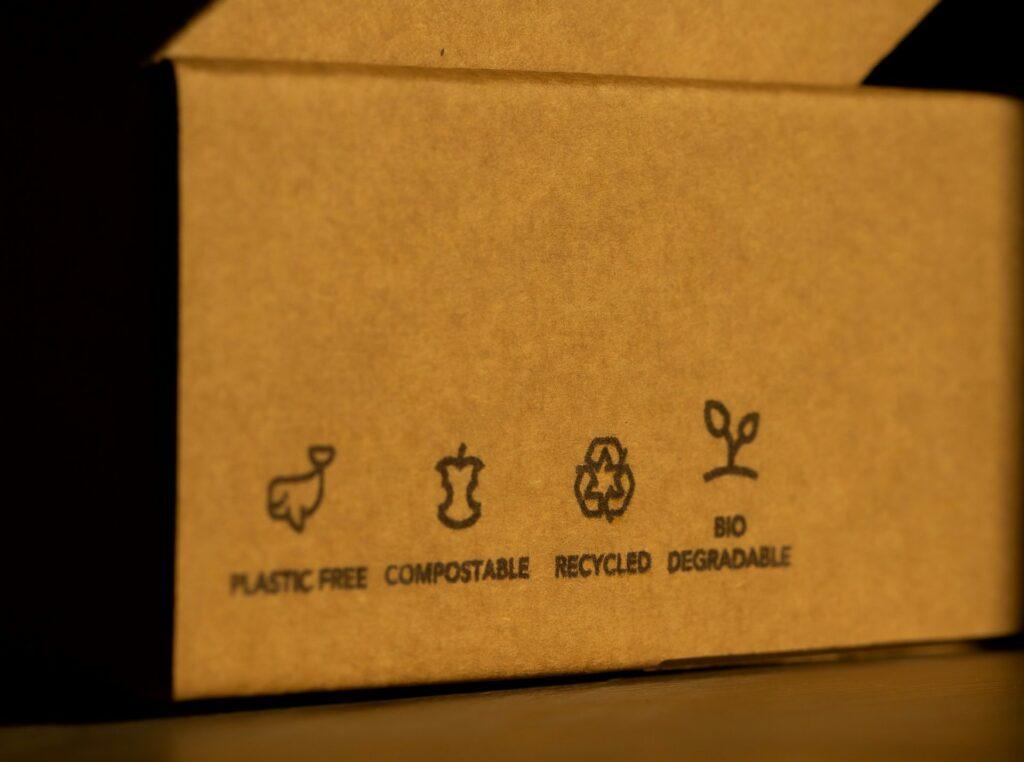
Zum Glück gibt es eine steigende Zahl an Modeunternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen und entweder als nachhaltige Marke starten, oder auf dem zugegebenermaßen langsamen Weg dahin sind. Es liegt bei den Konsument*innen, diese Sustainable Fashion von der Greenwashing Fashion zu unterscheiden.

